Unsere Meinung:
- Der äußere Eindruck:
Der BEYMA 15B100R-GH sieht wie ein klassischer 38er Bass aus: Druckgusskorb
mit 8 Befestigungslöchern, 12-fach geriffelte Papiermembran, 110 mm
durchmessende Staubschutzkalotte aus steifem Papier. Der Antrieb besteht
aus einem 224 mm durchmessender Magnet mit gegossener, rückwärtiger
Polplatte (mit 35 mm durchmessender Polkernbohrung) für besonders große
Auslenkungen und einer 100 mm durchmessenden und 15.5 mm hohen Schwingspule
in einem 10 mm hohen Lufspalt. Das ergibt rein rechnerisch "nur" einen
linearen Hub von +/- 2.75 mm. Nach den Erfahrungen der BEYMA-Leute bleibt
der Antrieb aber über einen größeren Bereich weitgehend linear, und
zwar abhängig von der Luftspalthöhe um +/- Luftspalthöhe/3.5. Damit
ergäbe sich dann ein linearer Hub von +/- 5.6 mm.
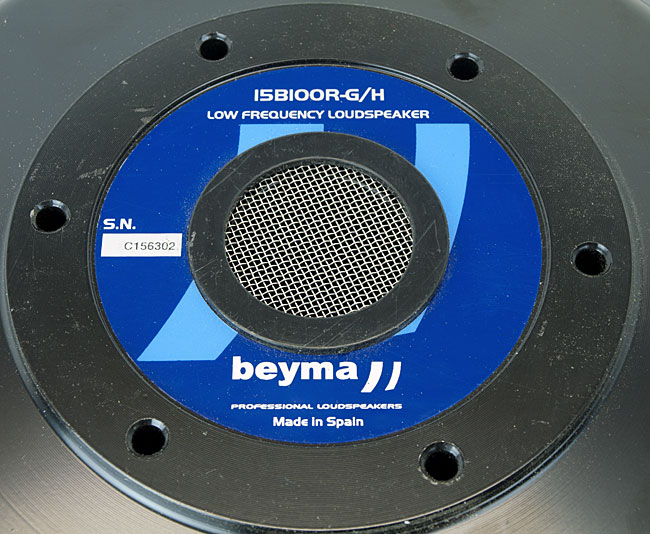

Das "besondere" am 15B100R-GH ist jedoch, dass er keine im PA-Bereich
übliche, mehrfach gefaltete Textilsicke hat sondern eine eher aus dem
HiFi-Bereich bekannte Schaumstoffsicke. In den 80er Jahren, der Hoch-Zeit
des Lautsprecher-DIY, war dieses Sickenmaterial sehr beliebt, fiel dann
aber in Ungnade, als es 10 bis 15 Jahre später reihenweise zu Sickenfras
kam. Mittlerweile sind die Schaumstoffsicken aber deutlich langzeitstabiler.
| Die "optimale"
Sicke Die Funktion der Sicke ist es (zusammen mit der
Zentrierspinne) die Membran zu führen. Die Einspannung in 2
Ebenen verhindert dabei auch ein Taumeln der Membran.
Die 2-teilige Führung soll:
- um die Nulllage herum ohne Losbrechmoment funktionieren,
- über eine möglichst lange Strecke möglichst linear sein
und
- bei darüber hinaus gehender Auslenkung durch einen progressiven
Anstieg der Steifigkeit dafür sorgen, dass der Schwingspulenträger
nicht gegen die hintere Polplatte donnert.
Die meisten dieser Aufgaben übernimmt die Zentrierspinne, da
sie an einer sehr steifen Stelle der Membran angreift (nämlich
am Schwingspulenträger, in der Nähe der Verklebung zur Membran).
Demgegenüber greift die äußere Sicke an einer sehr "wabbeligen"
Stelle der Membran an - dem äußeren Rand der Membran, der maximal
weit vom steifsten "Knotenpunkt" Schwingspulenträger/Membran/Staubschutzkalotte
entfernt ist. Damit die Bewegung der Membran möglichst wenig
beeinträchtigt wird sollte die Sicke also möglichst nicht zu
schwer sein und eventuell auftretende Schwingungen des "wabbeligen"
Membranrandes bedämpfen.
Wenn die Sicke schwer wäre würde die Massenträgheit der Sicke
die Membranbewegung am Rand reduzieren, im ungünstigsten Fall
würde der Rand deswegen sogar gegenphasig zum Rest der Membran
schwingen und einen Einbruch im Frequenzbereich erzeugen. Von
diesem "Sickenresonanz" genannten Phänomen sind vor allem größere
Breitbänder mit ihren sehr dünnen und daher am Rand wenig steifen
Membranen betroffen. Aber auch die Membran eines 38er Basses
ist am 316 mm durchmessenden Rand schon über 100 mm von der
100 mm durchmessenden Schwingspule und der 110 mm durchmessenden
Staubschutzkalotte entfernt.
Im Prinzip ist also eine leichte Schaumstoffsicke dazu geeignet
die Membran zwar zu führen, ansonsten aber nicht negativ zu
beeinflussen. Trotzdem muss die Membran natürlich selber dafür
sorgen, dass nicht ihr Eigengewicht am Rand oder eine fehlende
Membransteifigkeit zu Resonanzerscheinungen führt. Diese kann
die leichte Schaumstoffsicke dann nicht mehr so gut wie eine
dämpfend beschichtete, mehrfach gefaltete Textilsicke bedämpfen.
Schaumstoffsicken wird nachgesagt, dass sie ein besonders geringes
Losbrechmoment haben und daher besonders bei kleinen Auslenkungen
eine lineare Federkennlinie haben. "Dummerweise" ist die Schaumstoffsicke
nicht alleine dafür zuständig, denn die Zentrierspinne hat oftmals
sogar eine stärkere Federwirkung und dominiert daher die Gesamtfederwirkung.
Durch ihre geringe Masse und Eigensteifigkeit kann es bei
Schaumstoffsicken in geschlossenen Gehäusen und bei großen Auslenkungen
eher passieren, dass die Sicke vom Wechseldruck im Gehäuse beeinflusst
und von ihrer gewollten Funktion abgebracht wird. Bei einem
Subwoofer in einem kleinen, geschlossenen Gehäuse wäre eine
Schaumstoffsicke daher eine schlechte Wahl.
|
Wir sind mal gespannt, ob man die der Schaumstoffsicke nachgesagten
positiven Eigenschaften in den Messdaten wiederfinden kann . . .
- Die TSP:
Die gemessenen TSPs stimmen recht gut mit den Herstellerangaben bzw.
den Ergebnisse der Messungen bei K&T im Heft 05/2011 überein (dort wurden
übrigens dieselben Chassis gemessen wie bei uns):
| TS-Parameter |
Einheit |
BEYMA |
HiFi-Selbstbau |
K & T 05/2011 |
Resonanzfrequenz Fs
DC-Widerstand Rdc
Mechanische Güte Qms
Gesamtgüte Qts
Äquiv. Luftvolumen Vas
Membranmasse Mms
Kraftfaktor BL
Wirkungsgrad Eta (1m, Halbraum) |
[Hz]
[Ohm]
[-]
[-]
[dm³]
[g]
[N/A]
[dB/2.83V/m] |
30
5.4
10.894
0.252
248.96
119
21.8
98 |
28.21
5.38
11.446
0.22
313.33
109.97
21.64
98.6 |
26.51
5.29
7.47
0.2
355.99
111.13
21.42
98.6 |
Der lineare Hub ist mit rechnerischen +/- 2.75 mm ( (Schwingspulenhöhe-Luftspalthöhe)/2
) nicht gerade üppig, dafür sind in Freiluft (= Bassreflexbox) bei sehr
tiefen Frequenzen nur 1 Watt Verstärkerleistung nötig. In einem geschlossenen
Gehäuse wäre bei 50 Hz und einem Schalldruckpegel von 107 dB(Peak) eine
Spitzenauslenkung von +/- 2.75mm erreicht.
Im Impedanzverlauf deuten sich Membranresonanzen bei knapp 800, 1300,
1600 und 3000 Hz an, die sich - wie üblich - im Frequenzgang wiederfinden.
Die Impedanzerhöhungen sind auch im Datenblatt des Herstellers erkennbar.
Die TSPs lassen in einem "idealen" Bassreflexgehäuse keine Tiefbasswiedergabe
erwarten. Erst wenn man das Gehäuse deutlich größer macht, in Wandnähe
aufstellt und auf praxisgerechte 40 Hz abstimmt geht es tief genug hinunter:
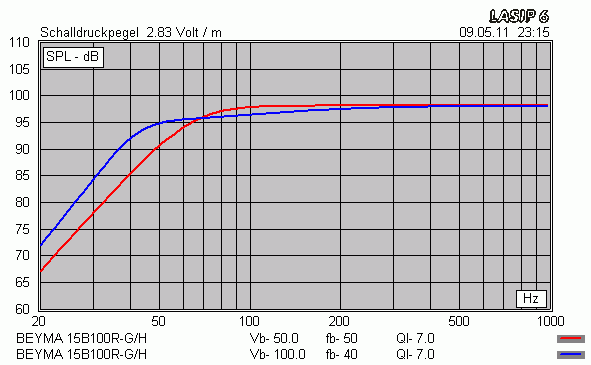
Da die maximale Übernahmefrequenz zum Mittel- oder Hochtöner ohnehin
unter 1 kHz sein sollte könnte man den sanften Anstieg zu hohen Frequenzen
hin auch durch eine etwas zu große Spule auffangen . . .
Die Streuung der TSPs ist bei den wesentlichen Parametern Rdc, Mms und
BL sehr gering.
- Der Frequenzgang:
Es ist immer wieder erstaunlich, wie linear der Frequenzgang von 38er
Basslautsprechern sein kann - auf Achse. Trotz des stattlichen Membrandurchmessers
schafft der 15B100R-GH dort eine obere Grenzfrequenz von etwa 1.6 kHz,
bevor er "abstürzt". Die obere Frequenzgrenze wird allerdings nur durch
eine "Doppelresonanz" bei 1.3 und 1.6 kHz erreicht und geht mit einem
Anstieg beginnend von ca. 600 Hz einher. Um 800 Hz gibt bereits eine
erste Membranresonanz.
Bis 500 Hz ist der Frequenzgang perfekt, darüber setzt dann auch die
Bündelung ein.
Im Zerfallspektrum sieht man verzögertes Ausschwingen bei 800, 1300,
1600 und 3000 Hz - diese Frequenzen kennen wir schon aus der Impedanzmessung.
Die Exemplarstreuung ist sehr gering. Das zeugt von einer guten Fertigungskonstanz.
- Der Klirrfaktor:
Der "harmonische" Klirrfaktor K2 verläuft weitgehend konstant. Der "unharmonische"
K3 zeigt Spitzen bei ca. 433 und 533 Hz (1/3 der Membranresonanzen 1300
bzw. 1600 Hz) sowie bei 1000 Hz (1/3 der Membranresonanz bei 3 kHz).
Auch K5 weist eine Doppelspitze bei 260 und 320 Hz auf (1/5 der Membranresonanzen
1300 bzw. 1600 Hz) sowie bei 600 Hz auf (1/5 der Membranresonanz bei
3 kHz).
Bei einem mittleren Schalldruckpegel von 90 / 95 / 100 / 105 dB liegt
K2 im Frequenzbereich von 40 bis 1000 Hz im Mittel bei 0.39 / 0.69 /
1.27 / 2.53%. Für K3 gilt in diesem Bereich ein Mittelwert von 0.16
/ 0.21 / 0.27 / 0.44%.
Gemäß des Artikels
Klirrfaktor - wie viel ist zu viel? wäre die K3-Klirrspitze bei
433/533 Hz gerade nicht hörbar, wohl aber die Spitze bei 1 kHz. Auch
die K5-Spitze bei 600 Hz ist hörbar. Bei sehr hochwertigen Systemen
sollte der 15B100R-GH daher nur bis max. 500 Hz zum Einsatz kommen.
- Die Pegellinearität:
Trotz des hohen Wirkungsgrades wurde die Pegellinearität bis 20 V gemessen,
das entspricht bei einem Wirkungsgrad von 98.5 dB/2.83V/m einem Schalldruck
von immerhin 115.5 dB!! Bis 600 Hz ist die Pegellinearität sehr gut,
darüber macht der 15B100R-GH zunehmend dicht, bei 1 kHz sind aber immerhin
noch 111.5 dB mit einer Dynamikkompression <= 1 dB machbar.
HiFi-Selbstbau-Fazit:
Der BEYMA 15B100R-GH ist ein "lauter" 38er Bass, der "Dank" seines
sehr starken magnetischen Antriebs ohne "Entzerrung" in einem Bassreflex-Gehäuse
nicht besonders tief kommt. Dafür gibt er sich mit 50 (F3 = 65 Hz) bzw.
100 Litern (F3 = 40 Hz mit Wand- bzw. Weichenunterstützung) Gehäusevolumen
zufrieden.
Der Klirrfaktor und der wellige Energiefrequenzgang verbieten (nach Papierform)
in sehr hochwertigen Systemen einen Einsatz > 500 Hz. Vergleicht man den
15B100R-GH mit anderen bereits von uns getesteten 38ern (z.B. dem
IMG Stageline SP-38PA/500BS oder dem in der HighLive eingesetzten (aber
leider nicht mehr lieferbaren)
P-Audio P150/2226), so hat jeder seine Stärken und Schwächen:
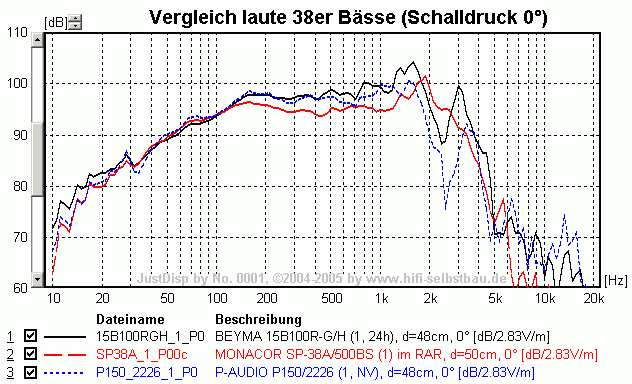
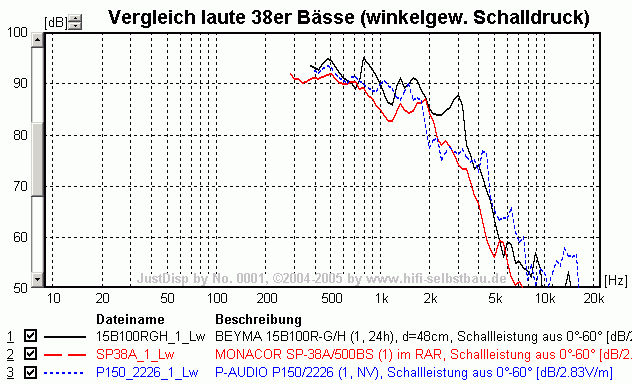
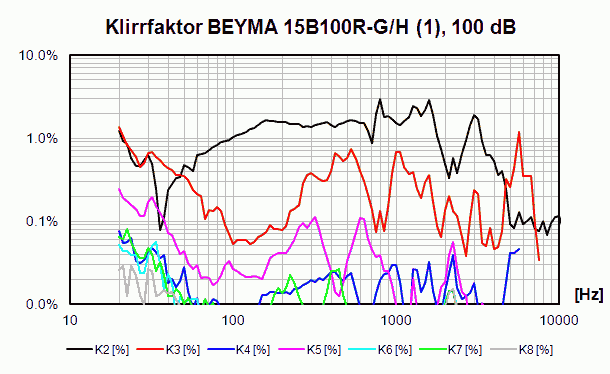
Beim Vergleich sieht man auch, WARUM der P-AUDIO P150/2226 in unserer
HighLive (Trennfrequenz 1.1 kHz) steckt ;-) Beide Alternativchassis benötigen
zwar ein größeres Gehäuse (z.B. 150 Liter), gehen dann aber auch ohne Pegelabfall
tiefer.
In wie weit die beobachteten Eigenschaften nun auf die Schaumstoffsicke
zurückzuführen sind kann man so nicht sagen, dazu wäre ein baugleiches Chassis
mit "normaler", mehrfach gewellter und bedämpfter Textilsicke oder mit Gummisicke
nötig. An der guten Pegellinearität und dem geringen Klirrfaktor im Bassbereich
könnte sie beteiligt sein ;), am welligen Frequenzgang aber leider auch
:(.
Die Hervorhebung eines Merkmals (z.B. Schaumstoffsicke, oder an
anderer Stelle AlNiCo-Magnet oder Feldspulen-Antrieb etc.) mag zwar marketingmäßig
zur Differenzierung zu anderen Produkten hilfreich sein, am Ende des Tages
besteht ein Lautsprecherchassis aber aus vielen Einzelteilen, die alle mehr
oder weniger miteinander interagieren und sehr sorgfältig aufeinander abgestimmt
sein wollen. So gesehen ist der BEYMA 15B100R-GH nicht besser (oder schlechter)
nur weil er eine Schaumstoffsicke hat.
Wenn der 15B100R-GH voll ins "Beuteschema" passt ist der UVP von 348
€ angemessen.
|
 Neuauflage
Neuauflage
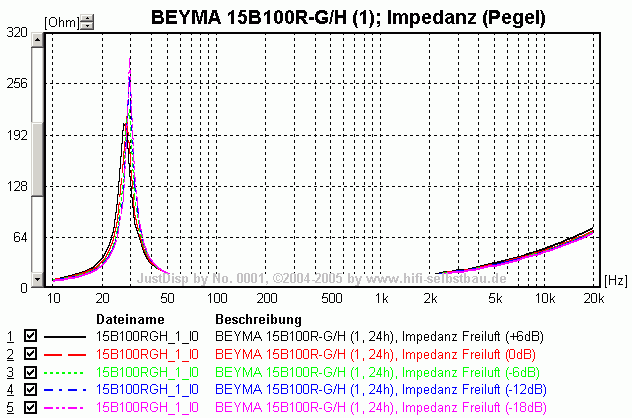
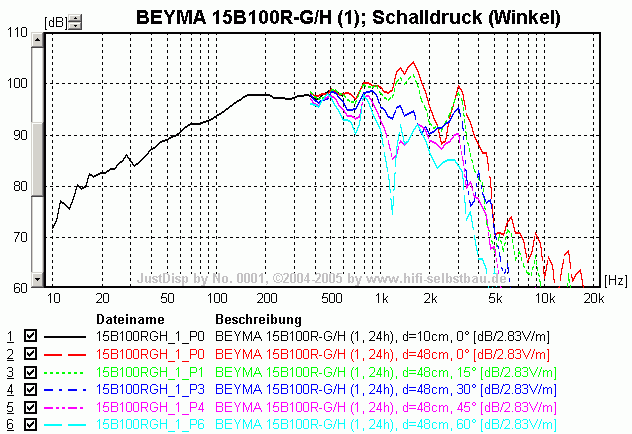
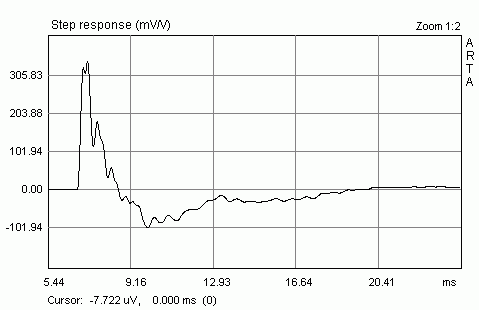
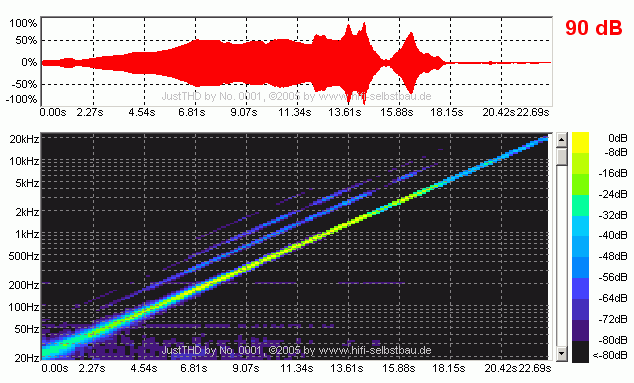
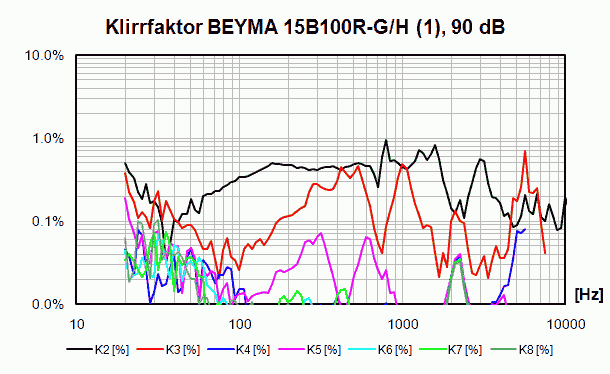


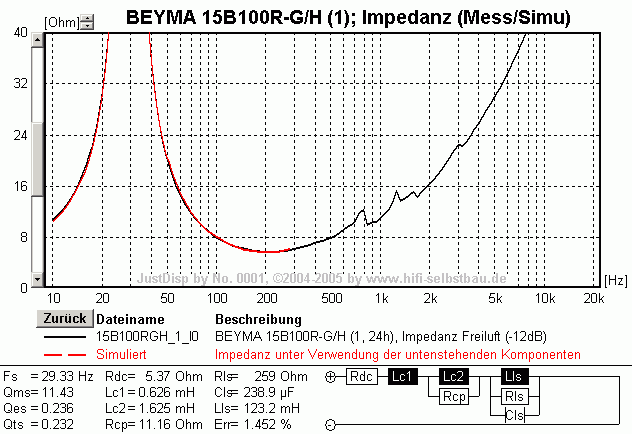
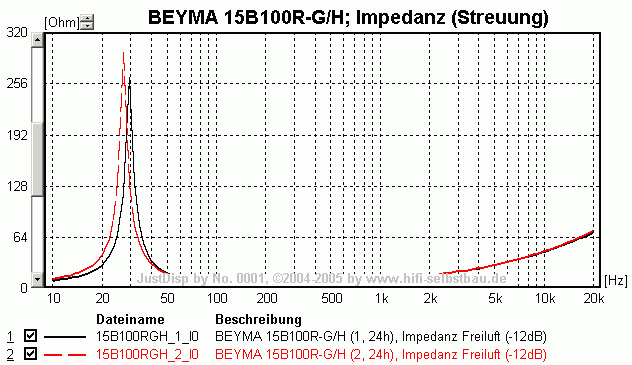
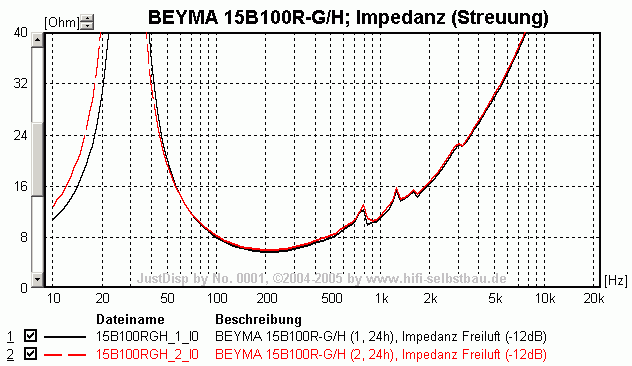
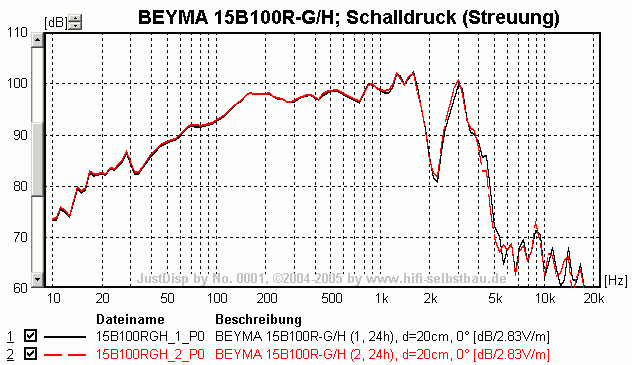
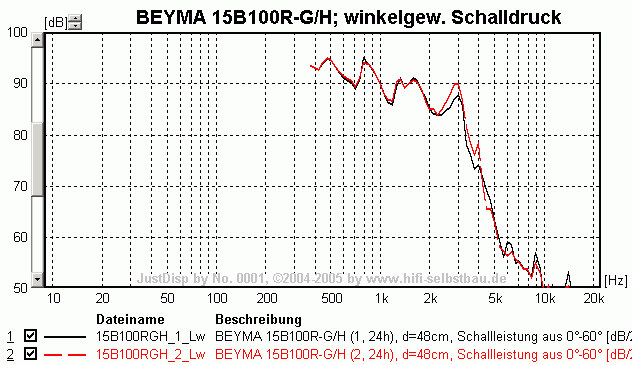
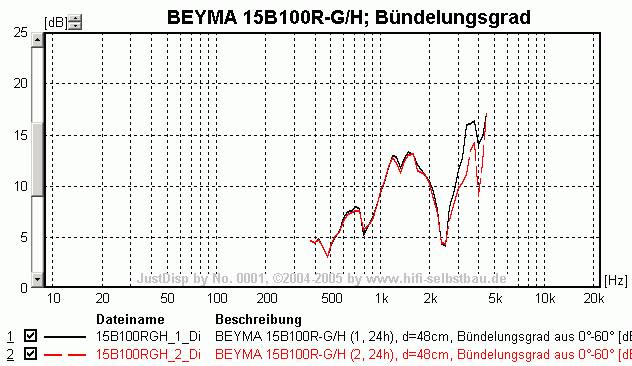
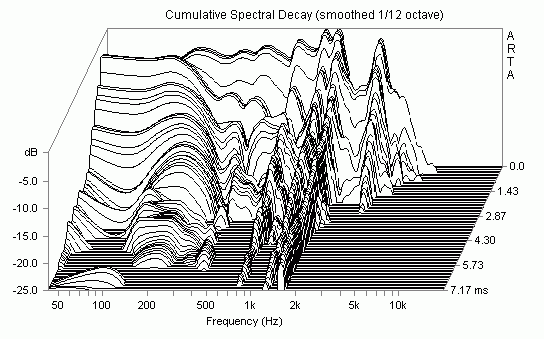
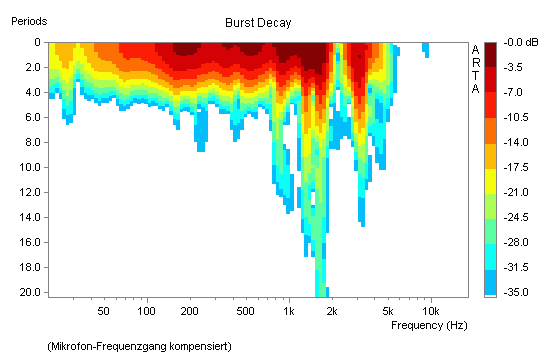
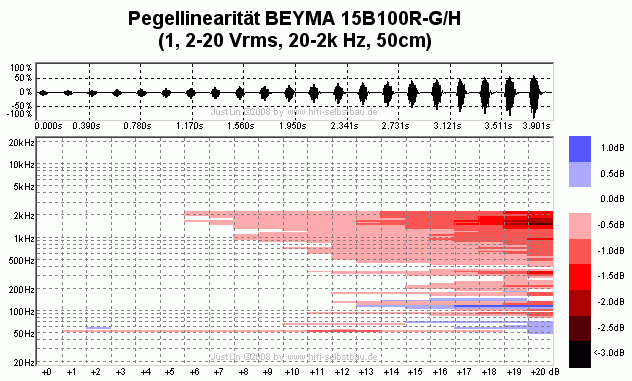
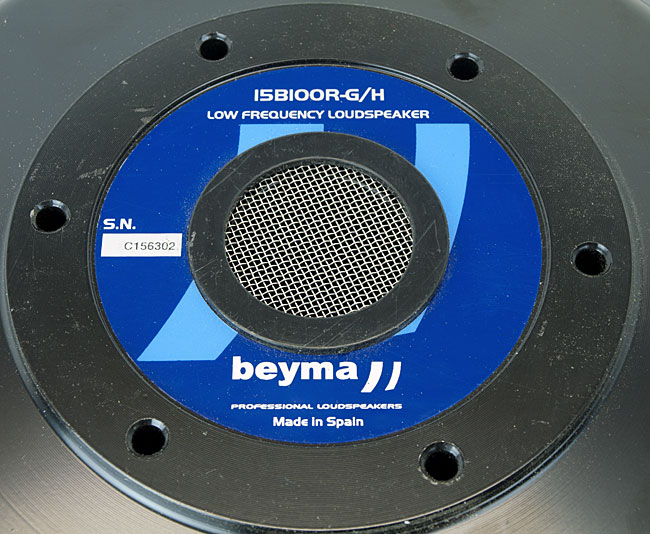

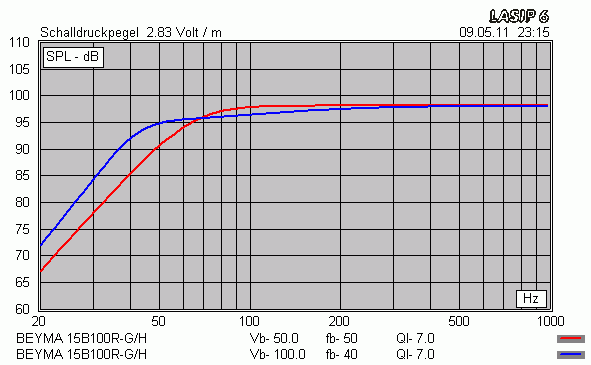
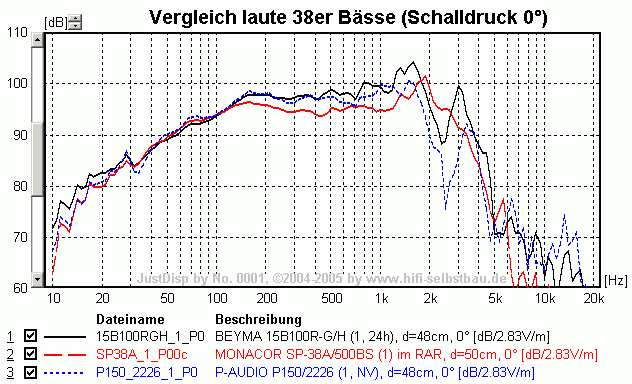
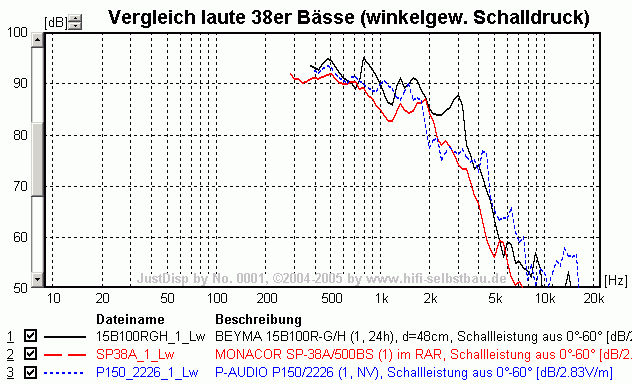
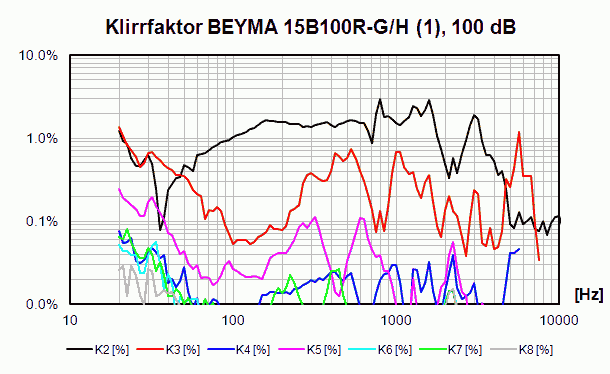
Kommentare
der im Text erwähnte P.Audio Bass P150/2226 ist jetzt schon über 1 Jahr aus dem Programm. Aber warum macht ihr ein Umweg; nehmt doch gleich das Original: JBL 2226H.
Ein vergleichbares Beyma Chassis ohne "Bröselsicke" ist das Beyma 15LX60-V2:
http://profesional.beyma.com/pdf/15LX60V2E.pdf
Lieben Gruß
Hauke
Bis ich Platz und Mittel hatte um mir grosse Boxen mit 15-Zöller zu leisten war die Zeit der weich-eingespannten vorbei also gab es für mich keine Alternative und auch keine test- bzw. Vergleichsmöglichkeiten mehr. Ich freue mich daher über den come-back des 15B100 (Audax's hat jetzt auch den grossen mit weicher Aufhängung).
Habe zur Zeit Onken W Nachbauten, allerdings nicht mit Altecs 515 oder 416, sondern mit dem Ciare 15.64 (also 2 pro Seite in 500L netto). Die Front ist aufgeschraubt und daher austauschbar bzw. mit anderen Treibern bestückbar.
Hat schon jemand versucht diese neuauflage des Beyma Klassikers in 200 bis 250 L einzubauen ? Es werden immer 80 bis 100 L Volumen empfohlen (so auch verschiedene Simu-Programme) aber der Bericht meint "Die TSPs lassen in einem "idealen" Bassreflexgehäuse keine Tiefbasswiedergabe erwarten. Erst wenn man das Gehäuse deutlich größer macht, in Wandnähe aufstellt und auf praxisgerechte 40 Hz abstimmt geht es tief genug hinunter".
Wieviel grösser also?